Sachsen richtet Ethikrat für „Künstliche Intelligenz“ ein
Experten sollen Regierung beim KI-Einsatz beraten Dresden/Chemnitz, 12. April 2024. Mit Blick auf die rasante Ausbreitung von „Künstlicher Intelligenz“ (KI) in Wirtschaft und Gesellschaft will die sächsische Landesregierung einen „Beirat für digitale Ethik“ einrichten. „Die darin berufenen Expertinnen und Experten sollen die Landesregierung bei Fragestellungen zum Einsatz von KI beraten und Empfehlungen aussprechen“. Das hat das Dresdner Kabinett im Vorfeld des dritten sächsischen KI-Kongresses angekündigt, der am 16. April 2024 in Chemnitz beginnt.


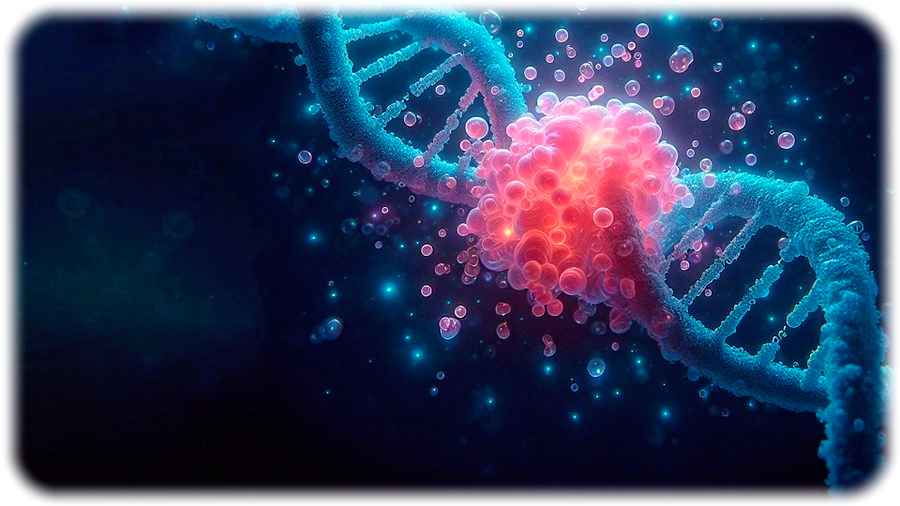
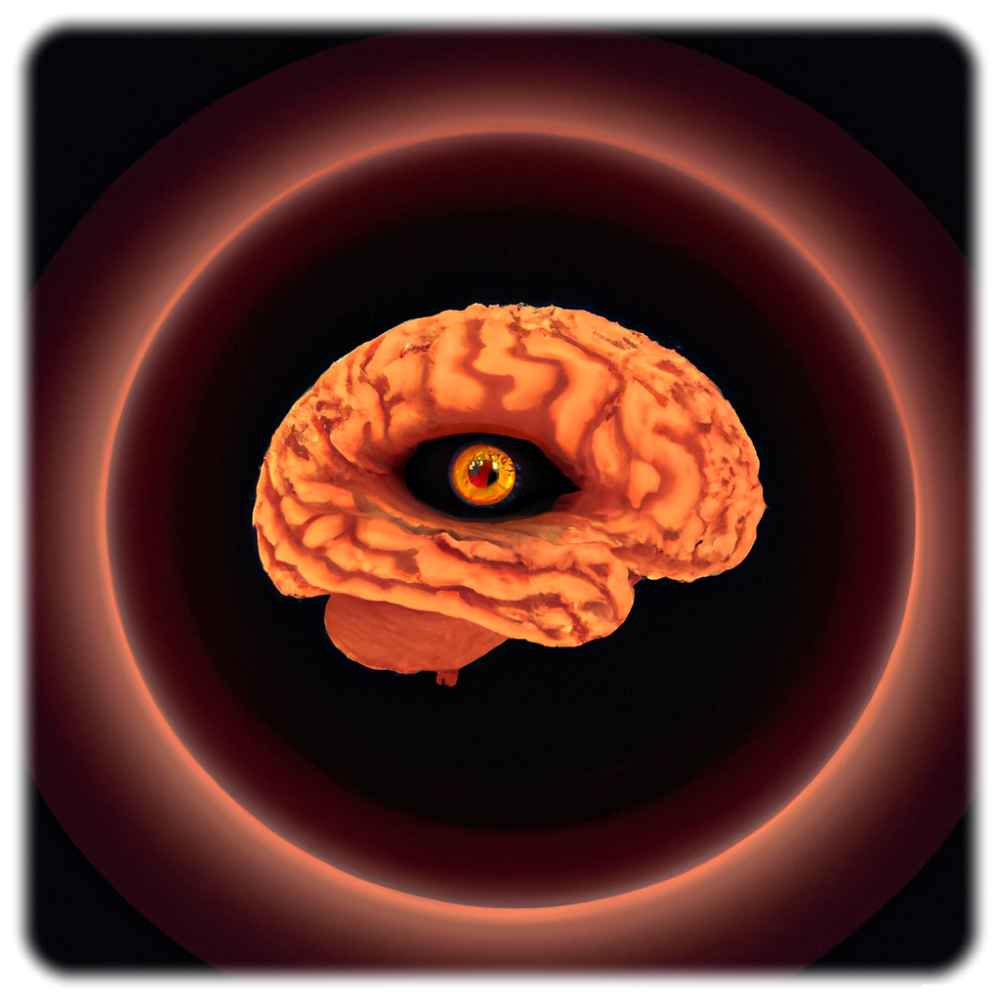
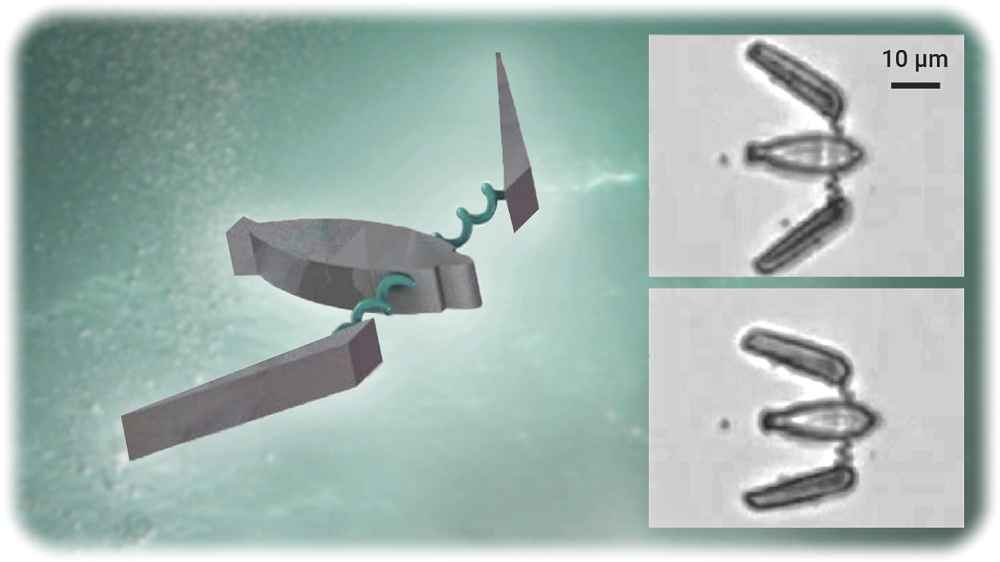


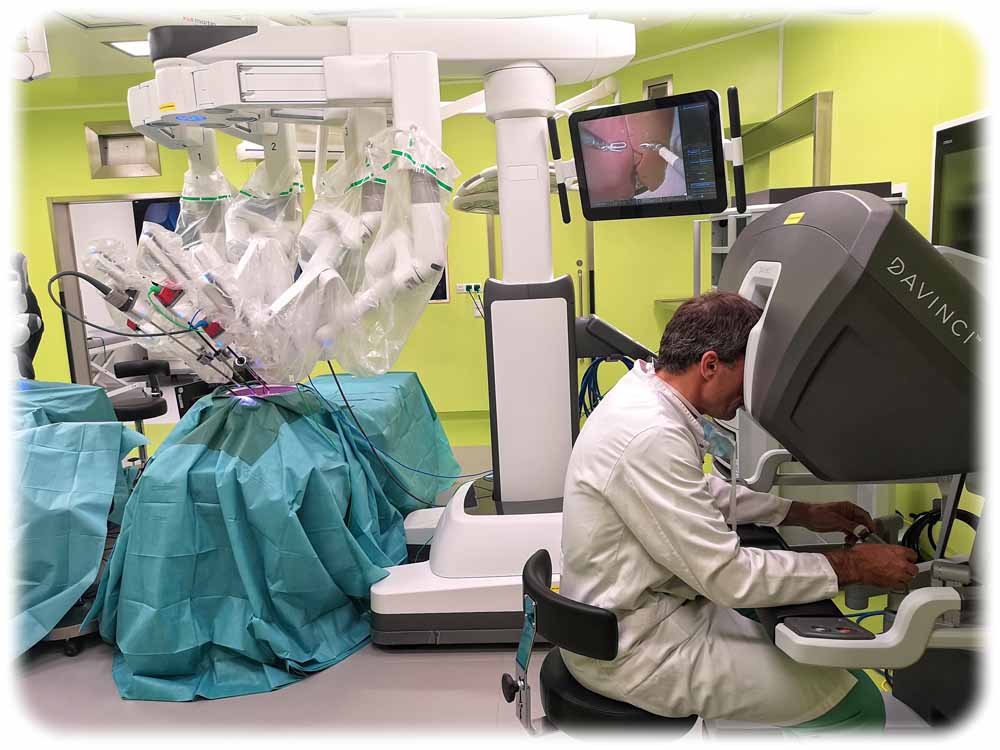



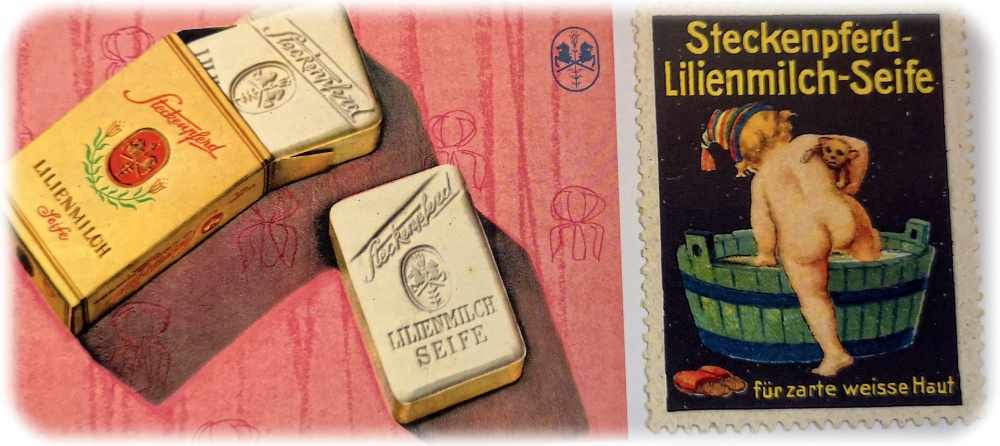
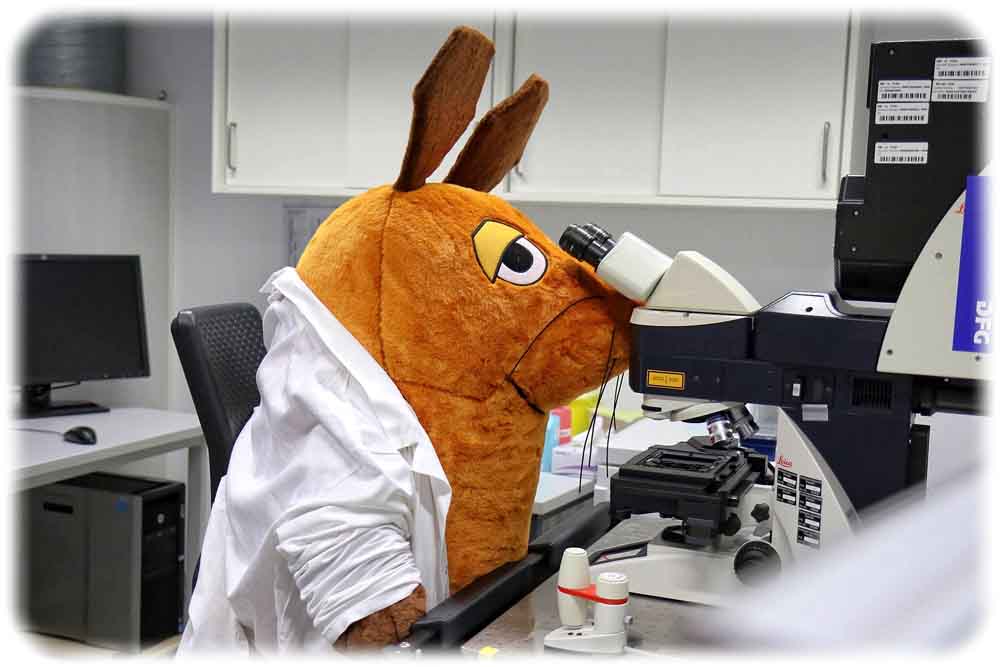
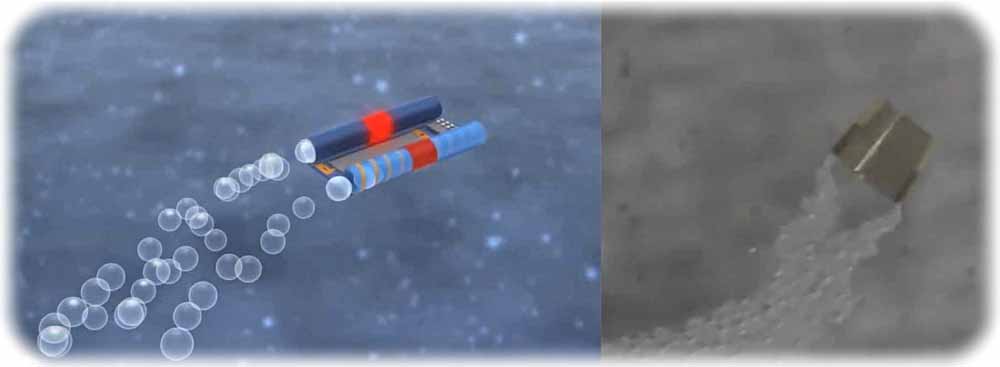

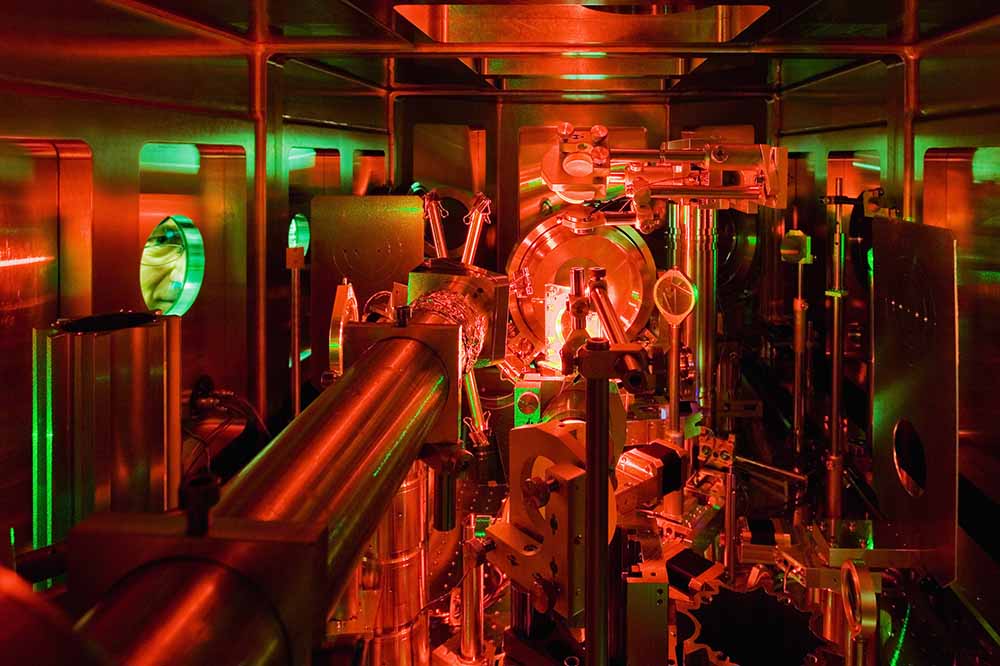
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.