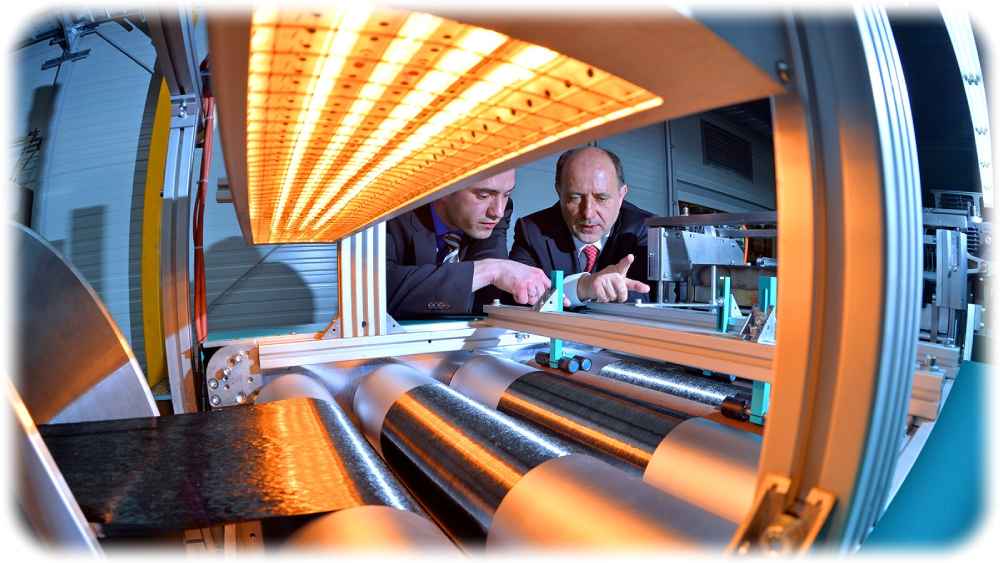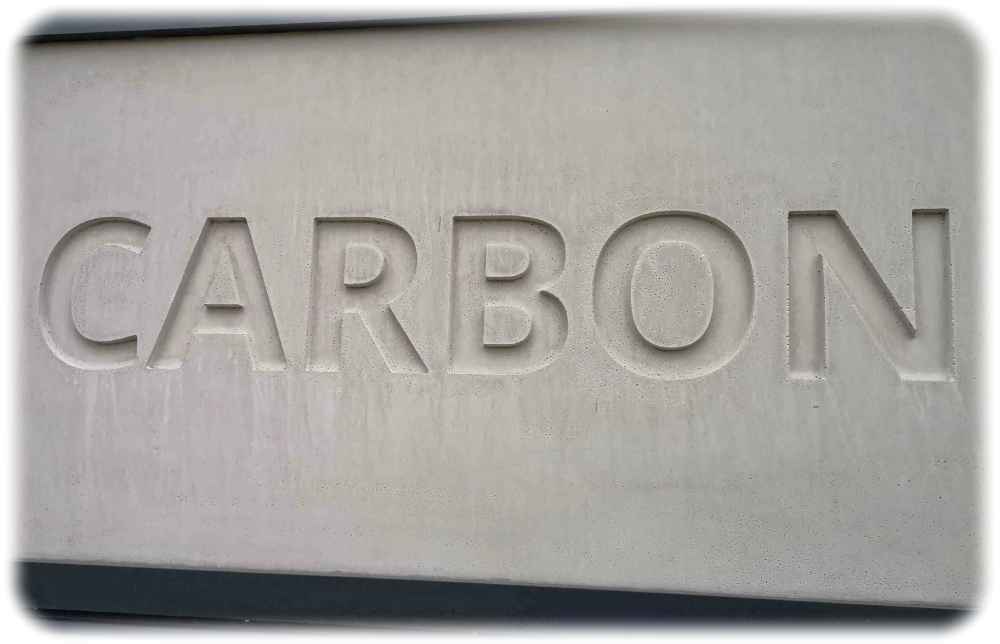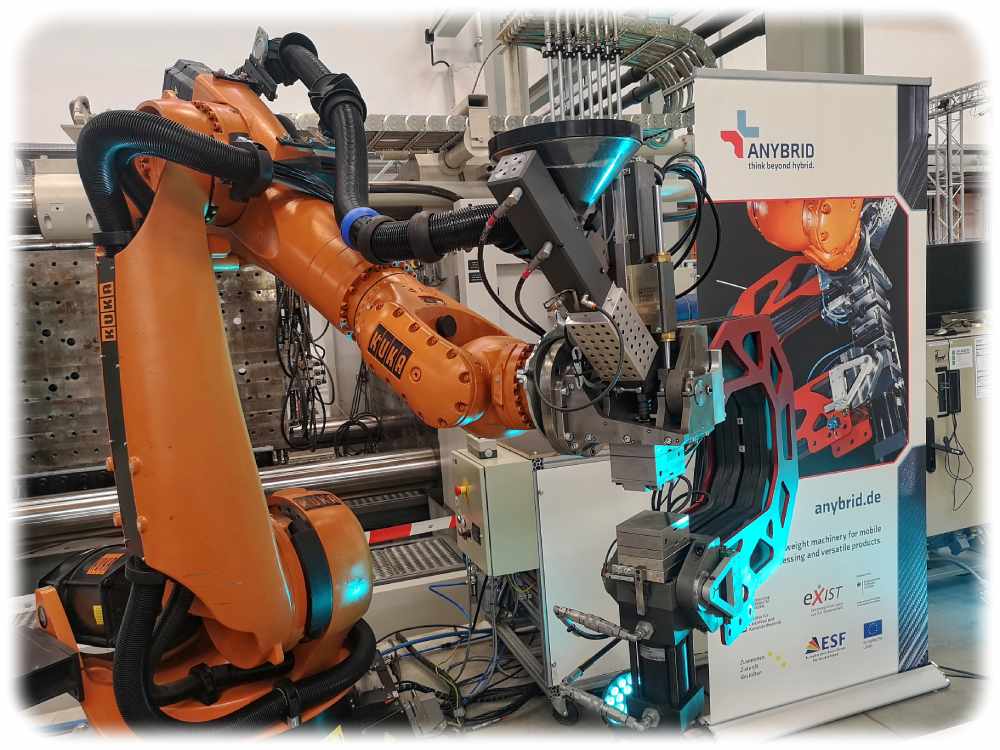Dresdner Carbon-Hocker kommt ins Designmuseum
Leichtbau-Möbelstück war auch technisch eine Pionierleistung Dresden/Weil am Rhein, 6. Dezember 2023. Der Dresdner Kohlefaser-Hocker „L1“ kommt ins Vitra-Design-Museum in Weil am Rhein. Das haben das Leibniz-Institut für Polymerforschung (IPF) Dresden und die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTWD) mitgeteilt, die dieses Leichtbau-Exponat vor über zehn Jahren entwickelt hatten.