
„Energy Saxony“-Chef Lukas Rohleder meint: Sachsen braucht mehr komplexe Beispielanlagen wie die Pilotanlage von Sunfire in Dresden-Reick, die Treibstoffe aus Kohlendioxid, Wasser und Ökostrom herstellen kann. Foto: Sunfire/ Cleantech Media
Verband: Freistaat kann Hochburg für Akku-Recycling, Elektrolyseur-Bau und Wasserstoffwirtschaft werden
Dresden, 27. November 2020. Sachsen könnte in den nächsten Jahren zu einem deutschlandweit führenden Standort für Batterie-Recycling, ökologische Wasserstoff-Erzeugung und den Elektrolyse-Anlagenbau aufsteigen. Das hat „Energy Saxony“-Chef Lukas Rohleder in Dresden eingeschätzt – der Branchenverband vernetzt rund 70 Unternehmen, Institute und Organisationen der sächsischen Energietechnikbranche. „Ich sehe auch gute Chancen, dass hier eine Fabrik für Batterien der nächsten Generation entsteht“, sagte er. Dies könne für viele neue Jobs im Freistaat sorgen.

Lukas Rohleder ist Geschäftsführer des sächsischen Energietechnologie-Branchenverbandes „Energy Saxony“. Foto: Heiko Weckbrodt
„Profitieren von hervorragender Wissenschaftslandschaft“
Die Voraussetzungen seien gut: „Wir profitieren hier einerseits von der hervorragenden Wissenschaftslandschaft in Dresden und ganz Sachsen“, erläuterte Rohleder. Andererseits decke ein wachsendes Netzwerk innovativer Energietechnik-Unternehmen immer mehr Glieder der Wertschöpfungskette vom Lithiumerz über die Energiespeicher-Produktion und den Spezialanlagenbau bis hin zur Rückgewinnung strategischer Materialien ab.
Komplexe Praxisbeispiele sollen Investoren locken
Allerdings müssten Bund und Land mitziehen. „Erstens brauchen wir Leuchttürme, die man im Praxiseinsatz vorzeigen kann: Komplexe Anlagen, die aus erneuerbaren Energiequellen mit großen Elektrolyseuren umweltfreundlichen ,grünen’ Wasserstoff erzeugen und Brennstoffzellen-Fahrzeuge betanken können. Damit kann man dann Unternehmer überzeugen, in der Lausitz, im mitteldeutschen Revier oder auch hier im Raum Dresden zu investieren“, erklärte der Verbands-Chef.

Prototyp einer neuartigen Schwefelbatterie mit hoher Energiedichte im Batterie-Technikum von Fraunhofer Dresden. Foto: Fraunhofer IWS
Mehr Wind-, Solar- und Biomasse-Kraftwerke für Sachsen gefordert
„Zweitens brauchen wir in Sachsen mehr erneuerbare Energiequellen, also mehr Windkraft-, Solar- und Biomasse-Anlagen.“ Dies sei einerseits für die ökologische Produktion von Wasserstoff (H2) wichtig. Anderseits werden „Dekarbonisierungs-Programme“ für angestammte deutsche Konzerne wie auch für Neuinvestoren wie den US-Unternehmer Elon Musk immer wichtiger: „Standorte, die genug erneuerbare Energiequellen haben und damit eine CO2-arme Produktion absichern können, haben heutzutage klare Standortvorteile“, meint Rohleder. Das habe sich jüngst erst bei der Ansiedlung der „Tesla“-Elektroautofabrik im windkraftstarken Brandenburg gezeigt.
Bund soll Öko-H2-Erzeuger von Abgaben befreien
Drittens sollte die Bundesregierung die Komplexanlagen für grünen Wasserstoff von Netzentgelten, Stromsteuer und Umlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) befreien. „Mit der heutigen Abgabenlast ist eine wirtschaftliche Produktion von grünem Wasserstoff kaum machbar.“
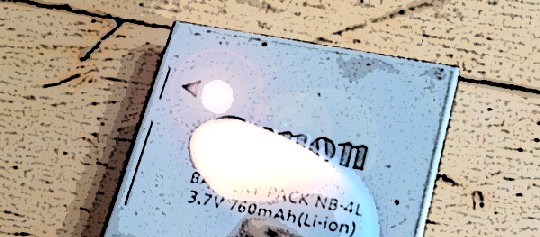
Was geschieht mit erschöpften Lithium-Akkus? Die Frage wird in den nächsten Jahren drängernder. Foto (bearbeitet): Heiko Weckbrodt
Akku-Recycling-Forschung vor allem in Freiberg
Solche Weichenstellungen könnten einen Wachstumsschub in der sächsischen Energietechnik-Wirtschaft auslösen. „Technologisch stehen wir schon gut da“, betonte der „Energy Saxony“-Geschäftsführer. Beispielhaft verwies er auf die fortschrittlichen Brennstoffzellen-Systeme, aber auch auf die neuartigen Batteriezell-Konzepte, die Fraunhofer Dresden entwickelt, und die für mehr Reichweite und geringe Kosten von Elektroautos sorgen sollen. Derweil arbeiten in Freiberg Wissenschaftler von der Bergakademie, Fraunhofer und Helmholtz an wegweisenden Methoden, um Wertstoffe aus all den Alt-Akkus, die eine wachsende Elektroauto-Flotte in Deutschland schon bald hinterlassen dürfte, zurückzugewinnen. Das Dresdner Fraunhofer-Keramikinstitut IKTS hat extra dafür eine neue Forschungs-Außenstelle für bessere Batterie-Recyclingmethoden in Freiberg gegründet. Und die Fraunhofer-Experten in Chemnitz gelten als Spezialisten für den Anlagenbau.

Stack-Produktion bei Sunfire Dresden: Aus den Zellen stapelt die Mitarbeiter die Kerne für Brennstoffzellen und Elektrolyse-Anlagen. Foto: Frank Grätz für Sunfire
Englisch-deutsche ITM Linde Electrolysis arbeitet an PEM-Elektrolyse
Hinzu komme ein wachsendes Netz aus innovativen Betrieben, betonte Rohleder. Einige davon wie etwa die Nickelhütte Aue, Muldenhütten Freiberg oder Liofit Kamenz haben schon langjährige Erfahrungen mit Batterie-Recycling und widmen sich nun neuen Akku-Sorten. Zudem gewinnt auch die sächsische Wasserstoff-Wirtschaft an Schlagkraft: Der Elektrolyse-Anlagenbauer Sunfire beispielsweise steht nach Einschätzung von „Energy Saxony“ vor einem Wachstumsschub, weil die Nachfrage für ökologisch erzeugten Wasserstoff in der deutschen Stahl- und Zementindustrie und im Schwerlastverkehr, perspektivisch deutlich steigen wird. „Zudem hat inzwischen das Joint Venture ,ITM Linde Electrolysis’ den Vertrieb seiner Elektrolyse-Module in Dresden konzentriert“, berichtete Rohleder. Punktete Sachsen bisher vor allem mit sehr effizienten, aber teuren Hochtemperatur-Brennstoffzellen des Typs SOFC, vertreibt das englisch-deutsche Gemeinschaftsunternehmen in Dresden nun auch preiswertere PEM-Niedrigtemperatur-Elektrolyseure.
Autozulieferer nehmen Brennstoffzellen-Antriebe ins Visier
Außerdem arbeiten – von der Öffentlichkeit erst wenig wahrgenommen – Vitesco in Limbach Oberfrohna, Voith in Zschopau, FES in Zwickau, die TU Chemnitz und viele andere sächsische Unternehmen und Institute an neuartigen Brennstoffzellen-Antrieben für wasserstoff-betankte Fahrzeuge. Und dies könnte sich noch als echter Wachstumsmarkt entpuppen: „Die EU will für den öffentlichen Nahverkehr bald einen gewissen Anteil emissionsfreier Fahrzeuge in den Flotten verpflichtend vorgeben“, argumentiert Rohleder. Für Busse und Lkws kämen batterieelektrische Konzepte wie bei den Elektroautos von VW & Co. nicht immer in Frage. Brennstoffzellen-Antriebe seien für Nutzfahrzeuge womöglich besser geeignet. „Sprich: Die Nachfrage für Wasserstoff-Fahrzeuge wird steigen.“
Autor: Heiko Weckbrodt
Quellen: Energy Saxony/Interview Rohleder, Oiger-Archiv, Hzwo, IKTS, ITM
Zum Weiterlesen:
Wasserstoffwirtschaft in Sachsen im Überblick
Müllberge von Altakkus werden größer

Ihre Unterstützung für Oiger.de!
Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:
Vielen Dank!



Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.