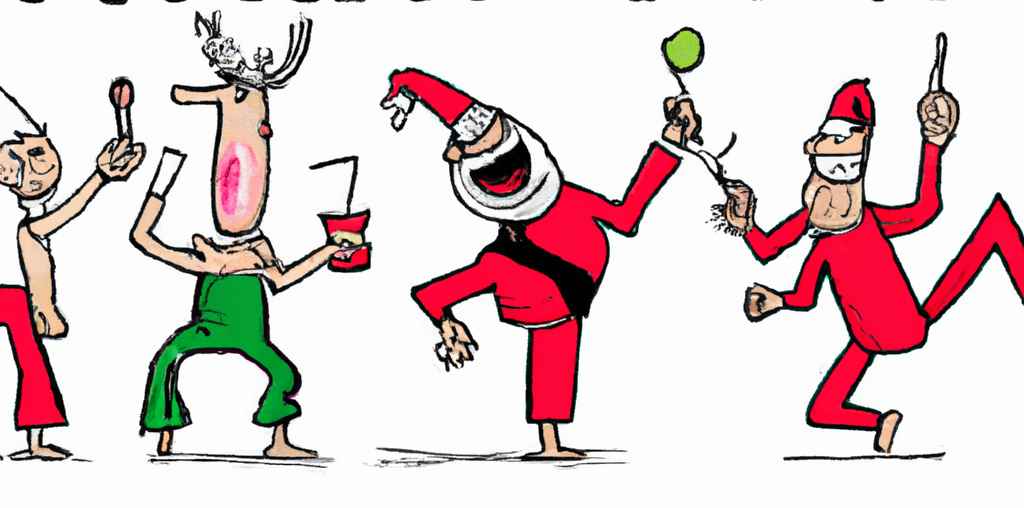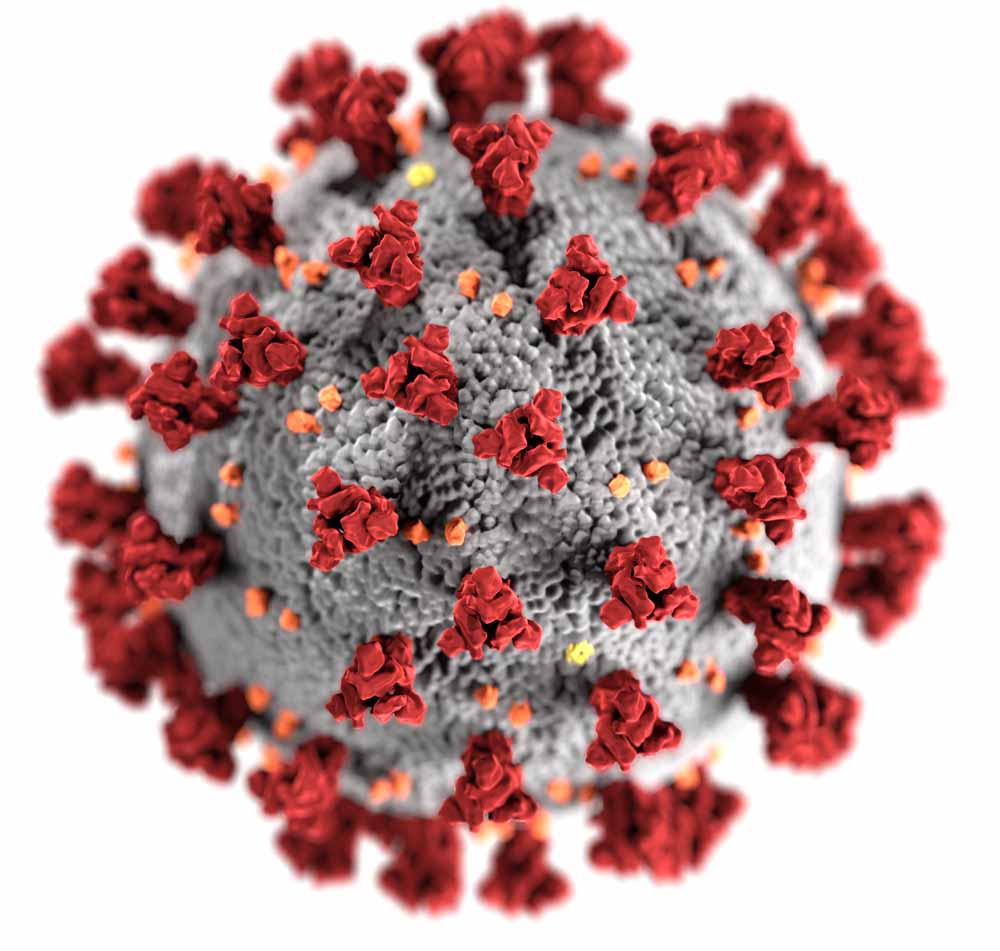Sachsens KI-Szene wächst
Zahl der KI-Unternehmen binnen 5 Jahren von 80 auf 200 gestiegen Dresden, 16. April 2024. Künstliche Intelligenz (KI) spielt als Technologie in Sachsen eine wachsende Rolle, zudem ist die KI-Wirtschaft im Freistaat in den vergangenen fünf Jahren deutlich größer geworden. Das geht aus Studien der sächsischen Digitalagentur und den Fraunhofer-Institutsteils „Entwicklung Adaptiver Systeme“ (EAS) aus Dresden hervor. Demnach ist die Zahl der identifizierbaren KI-Unternehmen seither von 80 auf nun rund 200 mehr als verdoppelt. „Klarer ,KI-Hotspot’ ist dabei die Landeshauptstadt Dresden: Hier sitzen 43 Prozent der sächsischen KI-Unternehmen“, heißt es in einer Mitteilung des sächsischen Wirtschaftsministeriums.