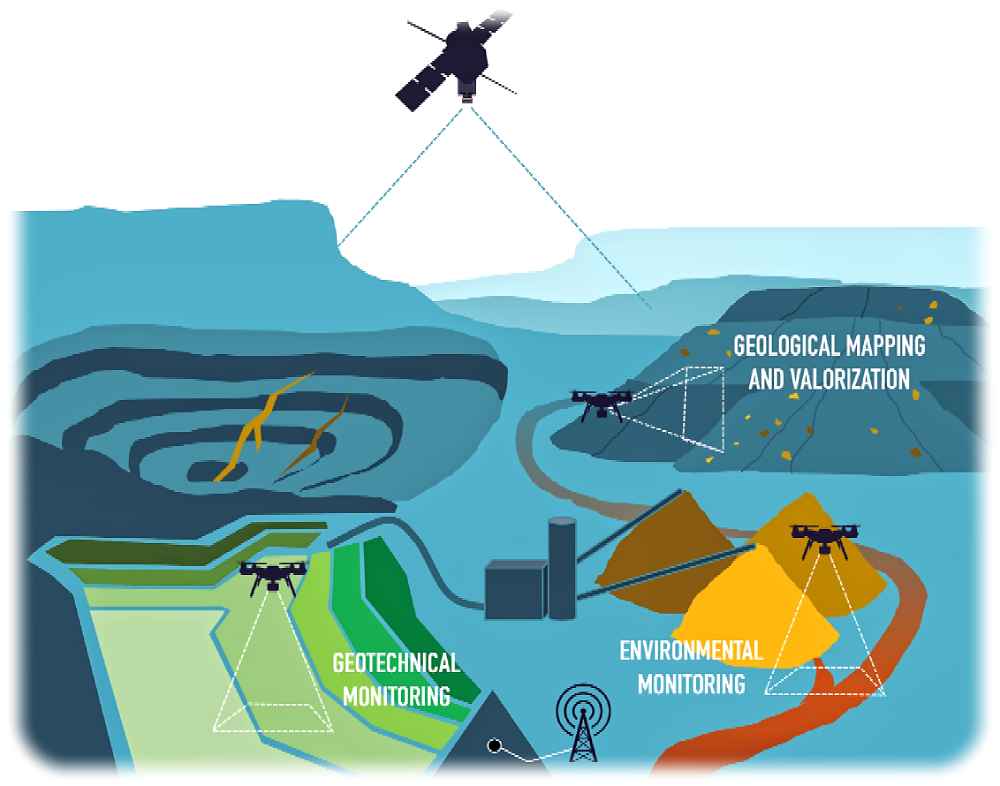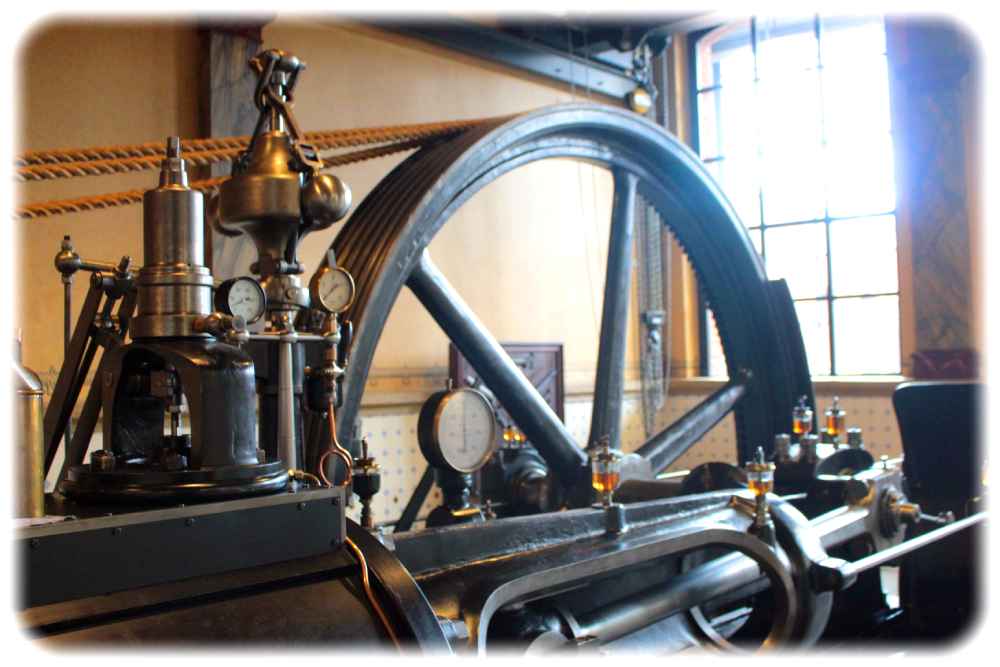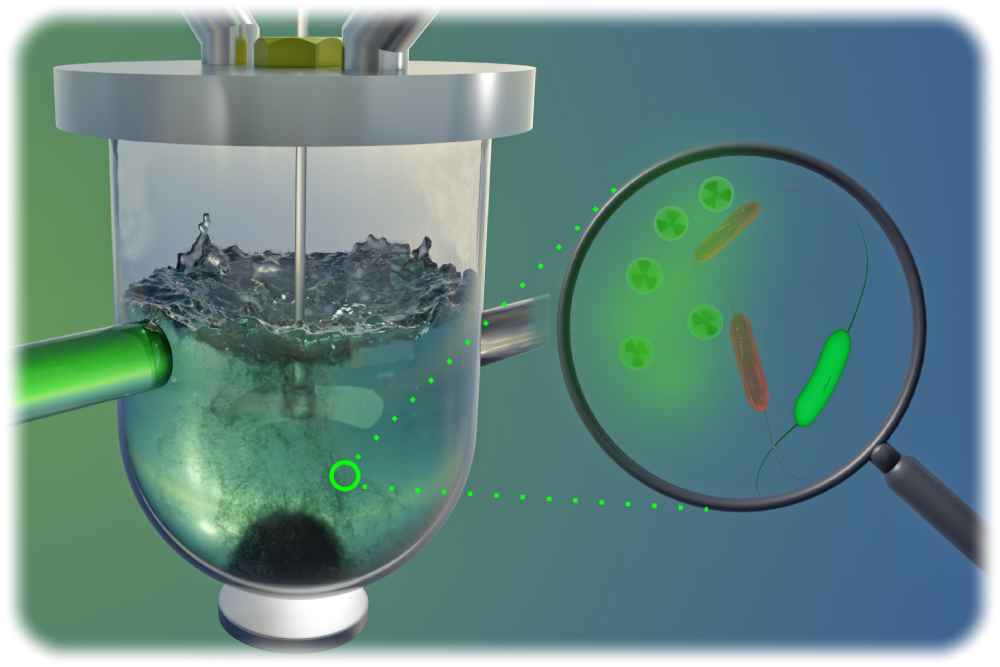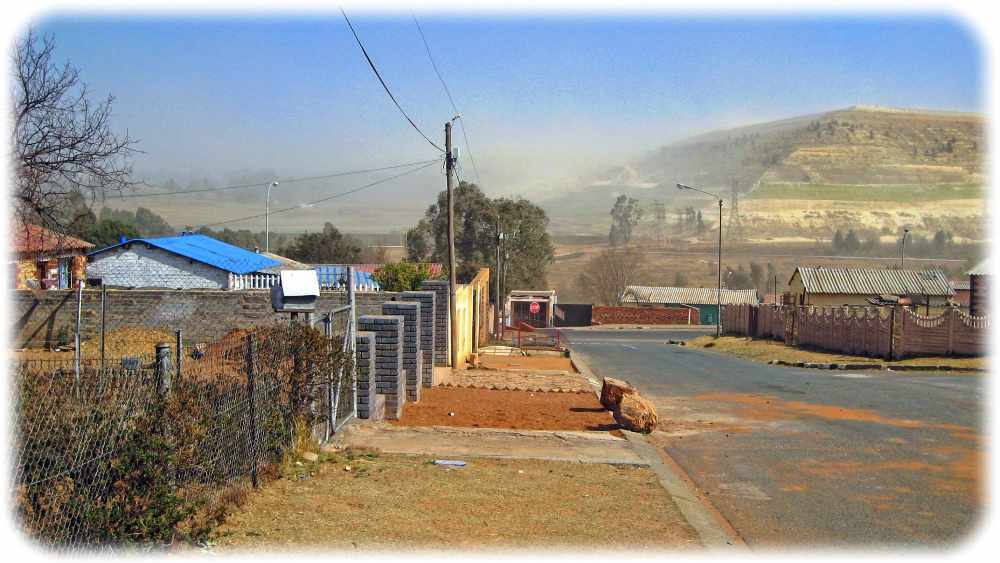Zeitzeugen-Wissen als „tragende Säulen der Industriekultur“ sichern
Landesverband Industriekultur Sachsen plädiert für weitere Befragungen Chemnitz/Dresden, 14. Januar 2024. Zeitzeugenberichte aus DDR-Betrieben sollten noch stärker als bisher erfragt und für die Nachwelt dokumentiert werden. Dafür plädiert der „Landesverband Industriekultur Sachsen“ (IKU) in seinem Ausblick für das Jahr 2024.