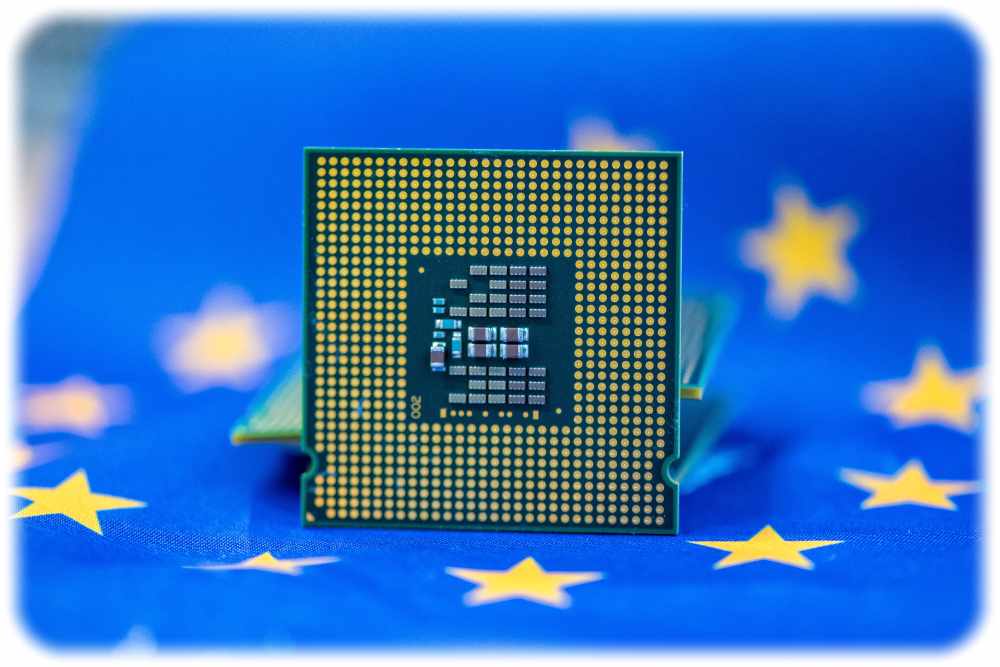
Die EU-Kommission plant ein europäisches Chip-Gesetz, um in der Mikroelektronik wieder etwas an Boden zu gewinnen. Foto: Christophe Licoppe für die EU-Kommission
Entwurf sieht nur elf Milliarden Euro Subventionen europaweit vor
Dresden/Brüssel, 9. Juli 2022. Auf Kritik ist der Brüsseler Entwurf für ein „Europäisches Chipgesetz“ in der sächsische Wirtschaft und Politik gestoßen. Der Hauptgrund: Gemessen an den großen Erwartungen, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyens (CDU) in den ersten Ankündigungen geschürt hat, ist nur mit vergleichsweise wenig Geld aus Brüssel für Europas Aufholjagd in der internationalen Halbleiterbranche zu rechnen.
Noch Anfang 2021 war von 145 Milliarden Euro die Rede gewesen
Der Entwurf sieht lediglich elf Milliarden Euro öffentliche Zuschüsse für die Mikroelektronik vor, wobei ein Teil dieser Summe zudem nur umgeleitetes Geld aus längst beschlossenen Fonds der EU und der Mitgliedsstaaten kommen soll. Weitere 32 Milliarden Euro soll die Industrie selbst aufbringen. Zum Vergleich: Noch Anfang 2021 hatte eine Initiative von 19 EU-Staaten – darunter Deutschland – eine Mikroelektronik-Initiative mit einer Finanzausstattung von 145 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Denn dahinter steht das ehrgeizige Ziel, den europäischen Marktanteil in der globalen Halbleiterindustrie von etwa sieben auf 20 Prozent zu verdreifachen.
Regionalminister Schmidt: Brauchen frisches Geld statt Mittelumleitung
Die nun aber stark limitierte Finanzausstattung für den „European Chips Act“ (ECA) sei „viel zu niedrig“, kritisierten Regionalvertreter in einer Stellungnahme in der Wirtschaftskommission (ECON) im Europäischen Ausschusses der Regionen (AdR). Zwar sei das „Europäische Chip-Gesetz die richtige Initiative zum richtigen Zeitpunkt“, erklärte der sächsische Regionalminister und AdR-Berichterstatter Thomas Schmidt – unterstützt von Frank Bösenberg, dem Geschäftsführer des sächsischen Branchenverbandes „Silicon Saxony“. Allerdings sei das Vorgaben unterfinanziert: „Die EU muss mehr Geld bereitstellen“, forderte er. Außerdem dürften die Programme, aus denen jetzt Fördermittel umgeleitet werden sollen, nicht geschwächt werden. Die sinnvollste Lösung sei daher, wenn die EU in ihrem nächsten „Mehrjährigen Finanzrahmen“ (MFR) für die 2028-2034 „mehr frisches Geld“ bereitstelle.
Halbleiter-Akademie vorgeschlagen
Außerdem regte Schmidt mehr Ressourcen für die Ausbildung von Mikroelektronik-Fachkräften und die Gründung einer „Halbleiter-Akademie“ an. Großes Potenzial sieht er auch „in einer gemeinsamen Beschaffung von Rohstoffen und Vorprodukten, um die Abhängigkeiten in internationalen Lieferketten zu reduzieren“.
Branchen- und Regionalvertreter gegen EU-Dirigismus
Anderseits lehnen die Regional- und Branchenvertreter im AdR den Plan der EU ab, in Krisenzeiten in die Halbleiterindustrie direkt hinein zu dirigieren. „Alle, mit denen ich gesprochen habe, waren sich einig, dass das in der Praxis nicht funktionieren kann“, betonte Minister Schmidt. „Vor allem eine kurzfristige Umstellung der Produktion ist bei Halbleitern kaum oder gar nicht möglich, verursacht hohe Kosten und braucht Zeit. Alle Maßnahmen, die Eingriffe in die Halbleiterproduktion bedeuten, dürfen nur ultima ratio sein. Ich habe die große Sorge, dass wir sonst Investoren abschrecken.“
TSMC-Pläne en passant bestätigt
Eine interessante Note am Rande, auf die Silsax-Geschäftsführer Bösenberg auf Twitter hingewiesen hat: Der Chipgesetzentwurf erwähnt nun ganz offiziell die Verhandlungen der taiwanesischen Groß-Foundry TSMC mit Deutschland über den Bau eine Chipfabrik- Auf eben diese Ansiedlung macht sich insbesondere Dresden große Hoffnungen, nachdem Sachsen bei der jüngsten Großinvestition von Intel leer ausgegangen war.
Autor: hw
Quellen: EU-Kommission, SMR, eppcor.eu, Oiger-Archiv

Ihre Unterstützung für Oiger.de!
Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:
Vielen Dank!


Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.