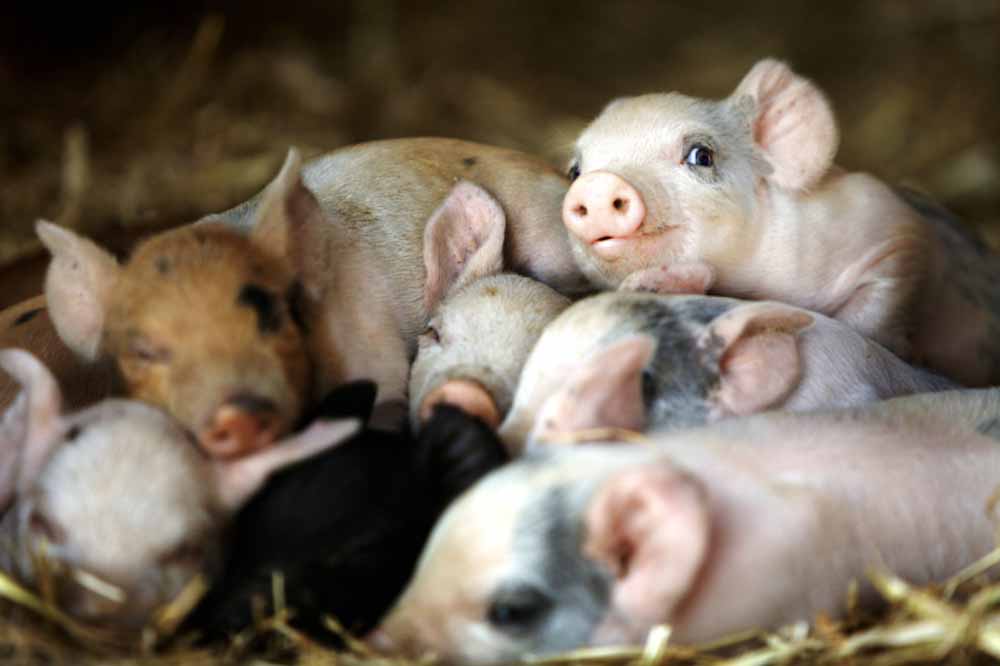Mehr Lebensdauer für heiße Elektrolyseure im Stahlwerk
Sunfire Dresden und Salzgitter AG forschen an Langzeiteinsatz und Serienproduktion Salzgitter/Dresden, 15. Dezember 2023. Damit Stahlwerke künftig Wasserstoff für die Eisen-Gewinnung umweltfreundlicher und effizienter als bisher gewinnen können, erproben Sunfire Dresden und die Salzgitter AG nun eine neuer Generation von Hochtemperatur-Elektrolyseuren (SOECs). Die sollen robuster als ihre Vorgänger sein, einen deutlich höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Wasserspalter erreichen und die SOEC-Großserienproduktion bei Sunfire vorbereiten. Das hat das sächsische Wasserstofftech-Unternehmen heute mitgeteilt. Zudem beteilige sich auch die Bergakademie Freiberg an dem „GrInHy3.0“ genannten Projekt, um bei der Gelegenheit gleich Wiederverwertungs-Möglichkeiten für die neuen Elektrolyseure auszuloten.