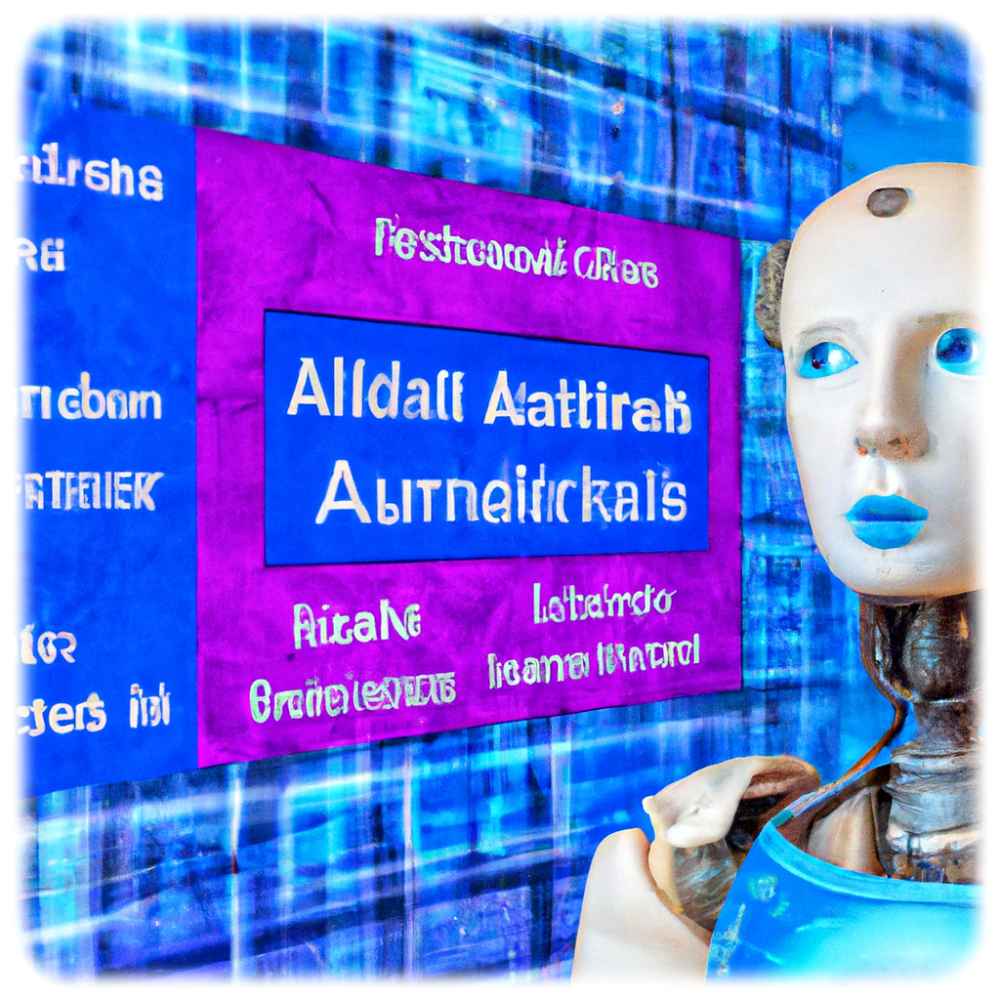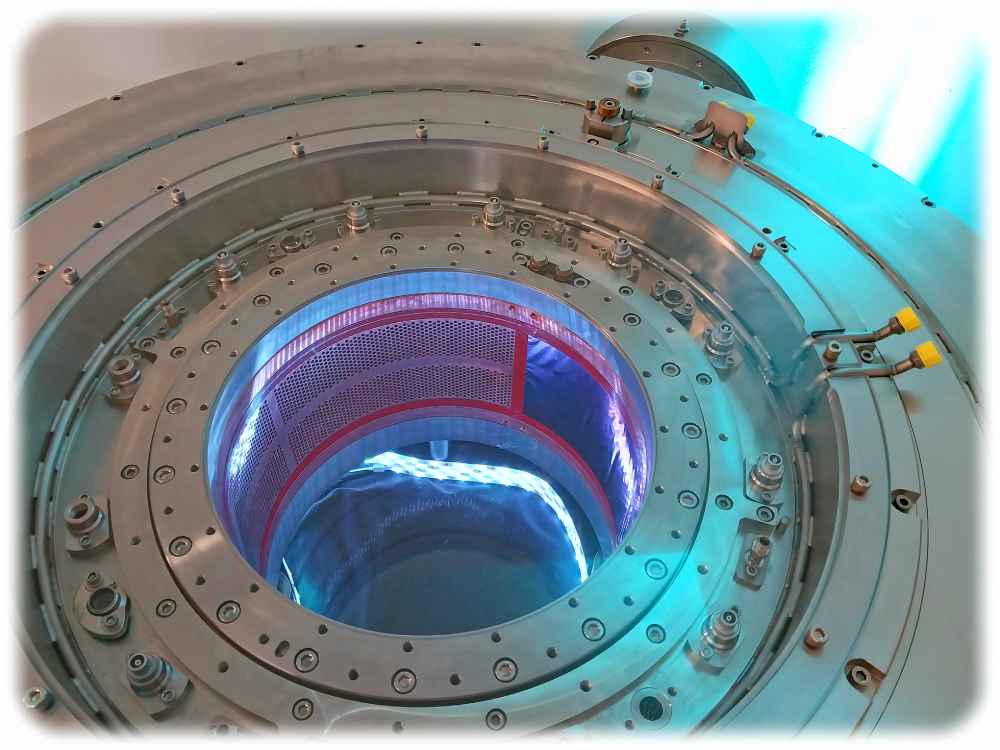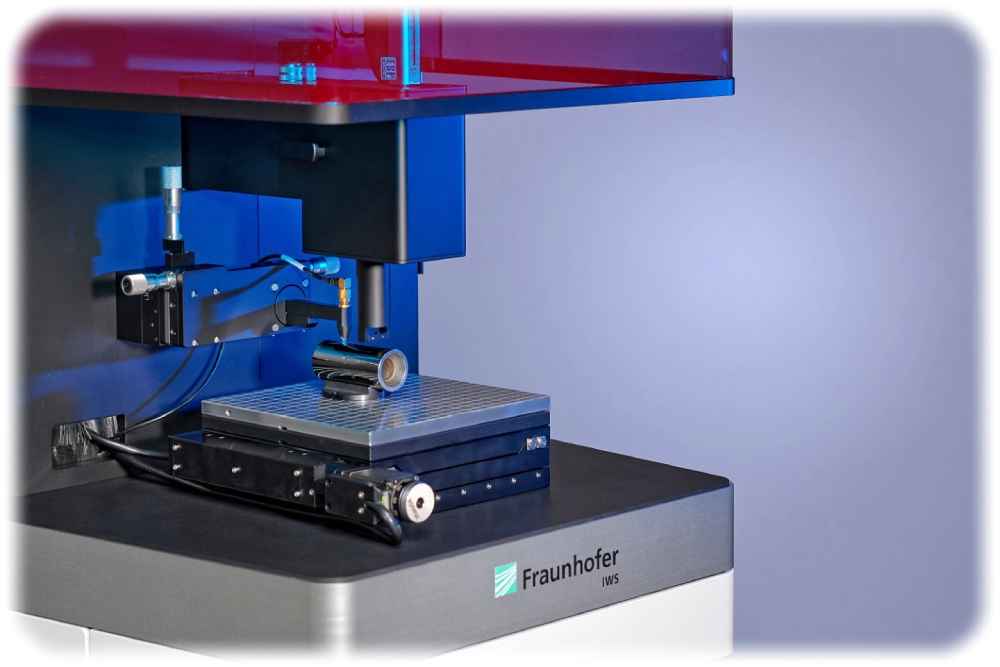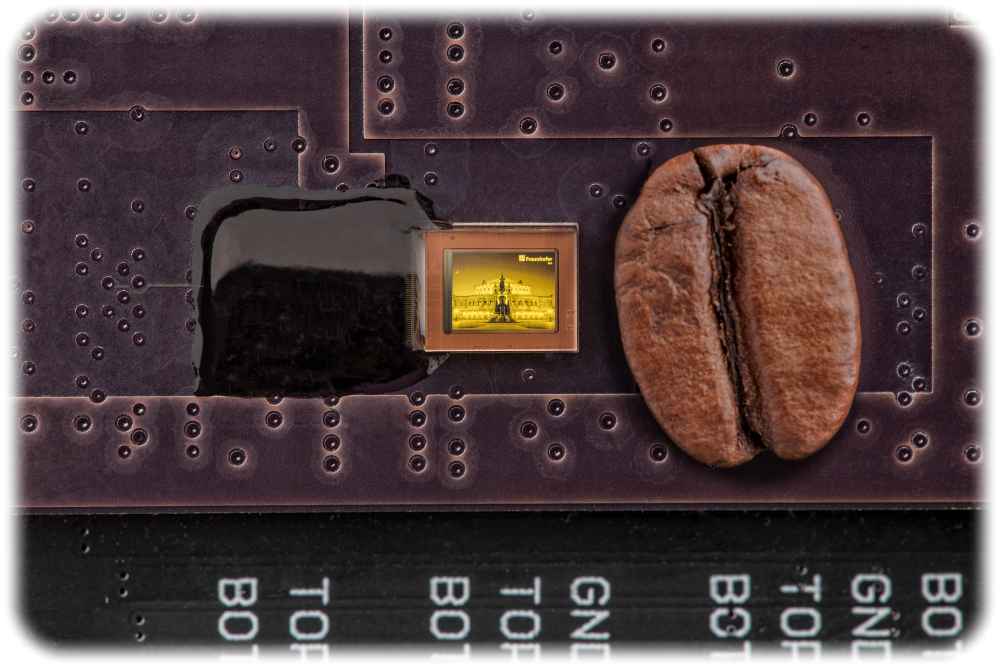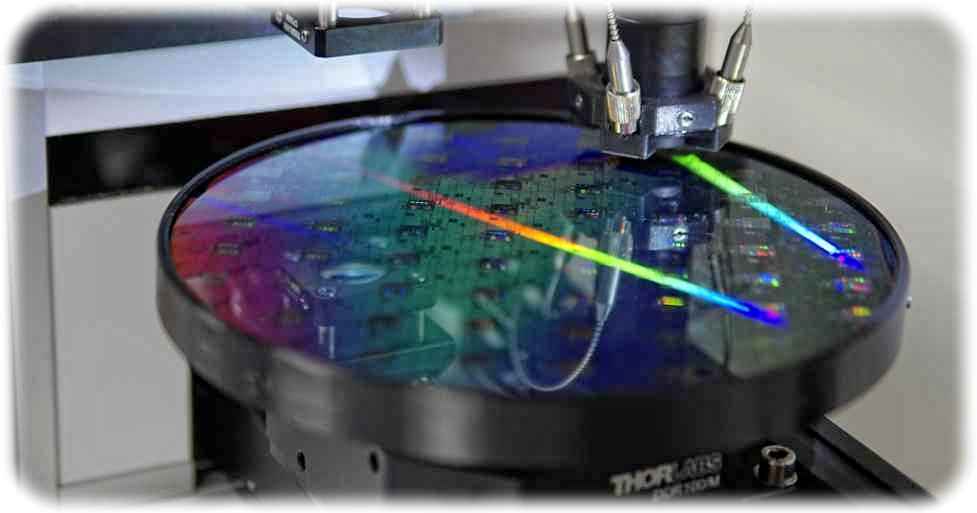Jedes 2. deutsche Unternehmen setzt Künstliche Intelligenz ein
Vor allem Text-Erstellung und Datenanalyse gefragt Köln, 19. April 2024. Künstliche Intelligenz (KI) durchdringt auch in Deutschland mit hohem Tempo die Wirtschaft. Mittlerweile setzt bereits jedes zweite deutsche Unternehmen KI-Techniken ein – sei es nun für Text-Genese, Datenanalyse, Automatisierung oder die Programmierung von Software-Paketen. Das geht aus einer „Civey“-Umfrage unter rund 500 Informationstechnologie-Entscheidern für den deutschen Internetwirtschafts-Verband „Eco“ aus Köln hervor.