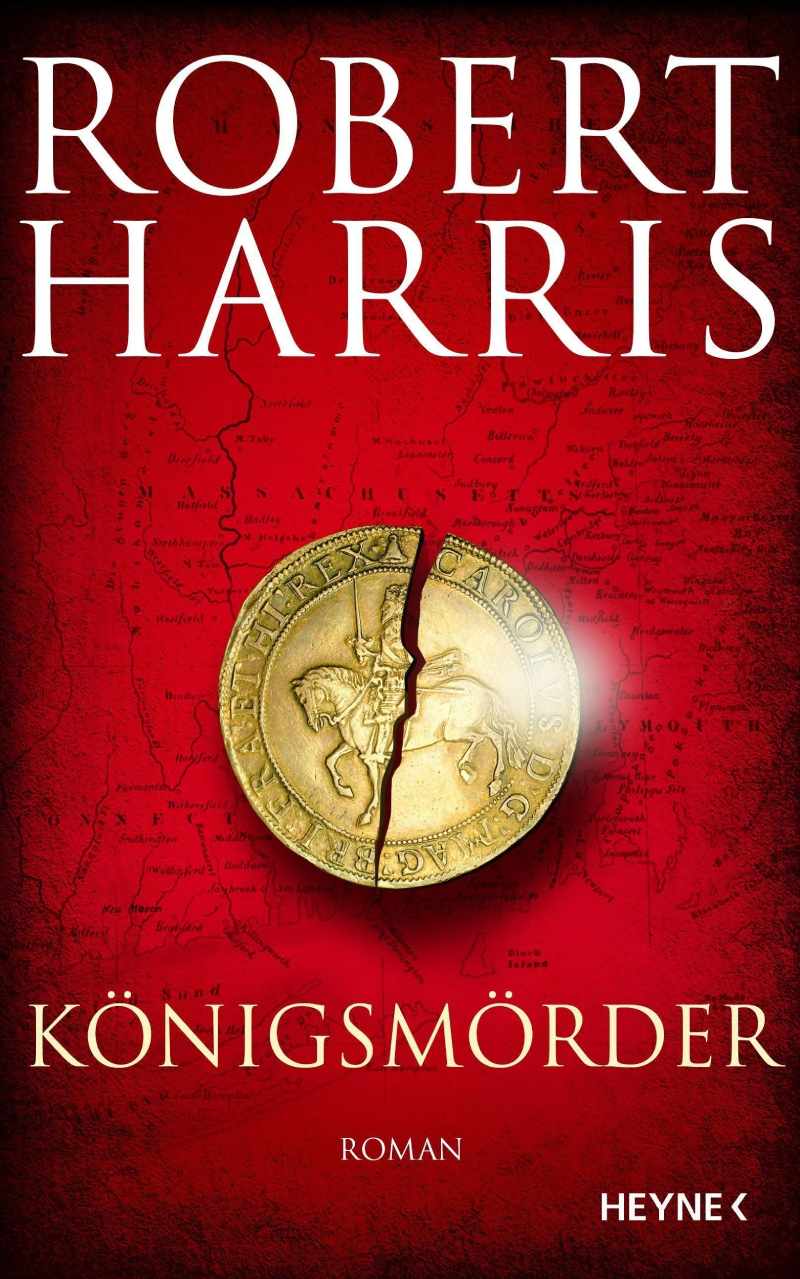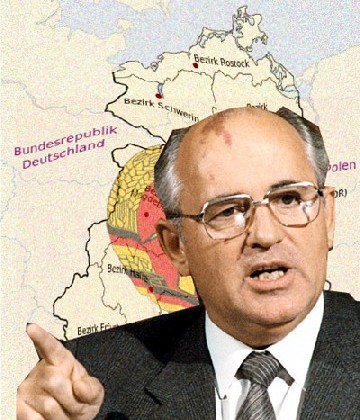Bezirksrechenzentren sollten in DDR für Digitalisierungs-Schub sorgen
Leitbeschluss vor 60 Jahren – später wurde aus dem VEB Maschinelles Rechnen das „Kombinat Datenverarbeitung“ Berlin/Dresden, 3. Januar 2024. Vor 60 Jahren starteten die ostdeutschen Wirtschaftslenker in Berlin einen wichtigen Anlauf, um die weltweiten Umwälzungen hin zu elektronischen Computern und digitalen Lösungen auch in der DDR systematisch anzugehen: Zum Jahreswechsel 1963/64 beschloss der SED-geführte Ministerrat ein Bündel aus „Sofortmaßnahmen zur Entwicklung der Datenverarbeitung“. Einige davon wurden in den Folgejahren realisiert. Andere scheiterten an Ressourcenmangel, wegen des Machtwechsels von Ulbricht zu Honecker, teils aber auch in Reaktion auf neue Trends.