
Ein Ko-Chirurg sitzt während der OP die ganze Zeit am Patienten und beim Roboter, um dort einzugreifen, wo der Roboter an seine Grenzen stößt. Foto: Heiko Weckbrodt
Die Fortschritte der Mikroelektronik machen hochpräzise Eingriffe möglich, bei denen der Arzt bis zu sechs Roboterarme fernsteuert – seit 2006 setzt auch das Uniklinikum Dresden solche OP-Roboter ein
Dresden. Der OP-Saal ist angenehm temperiert, vom heißen, hellen Sommertag draußen dringt kaum etwas durch die Fenster hinein. Kleine Scheinwerfer leuchten Tische mit blitzenden Instrumenten und Geräte mit bunten Anzeigen aus. Das Innere eines pochenden rosa Brustkorbs füllt einen großen Flachbildschirm in Augenhöhe aus. Doch die sieben Männer und Frauen in ihren blauen Kitteln haben kaum einen Blick dafür, schauen konzentriert auf Sinuskurven – und den übermannshohen Roboter in der Mitte des Saals, der mit seinen sechs Armen über dem OP-Tisch thront. „Saugen!“, befiehlt eine Stimme aus dem Hintergrund. Sie kommt von Professor Jürgen Weitz und der sitzt ganz hinten in der Ecke. Er hat sich über die Sichtfenster eines Terminals gebeugt. „Die Falte bitte etwas zur Seite drehen!“ Ein zweiter Chirurg direkt neben dem OP-Tisch greift zu seinen Instrumenten, hilft dort aus, wo der Roboter nicht so richtig herankommt. Auf dem Monitor erscheint ein Greifer, der das rosa Gewebe auseinanderzieht. „Ja, jaaa… gut so…“ Weitz dreht an seiner Konsole beide „Joysticks“ gleichzeitig, sanft und elegant machen zwei Greifer die Bewegung auf dem großen Bildschirm nach.

Prof. Jürgen Weitz steuert von einer Konsole aus die Bewegungen des Operations-Roboters und sieht dabei ein 3D-Bild aus dem Körper des Patienten. Foto: Heiko Weckbrodt
Chirurg steuert den Telemanipulator
Wir sind Zeuge einer jener Operationen, die landläufig „Roboter-OPs“ genannt werden, obwohl der Fachausdruck eigentlich „Telemanipulator“ heißt: „Der sogenannte Roboter macht hier gar nichts selbstständig, sondern setzt einzig die Bewegungen der Chirurgen um“, erklärt der Direktor der Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie im Universitätsklinikum Dresden. „Trotzdem hat sich der Begriff ,Roboter-OP’ eingebürgert“, sagt Prof. Weitz.
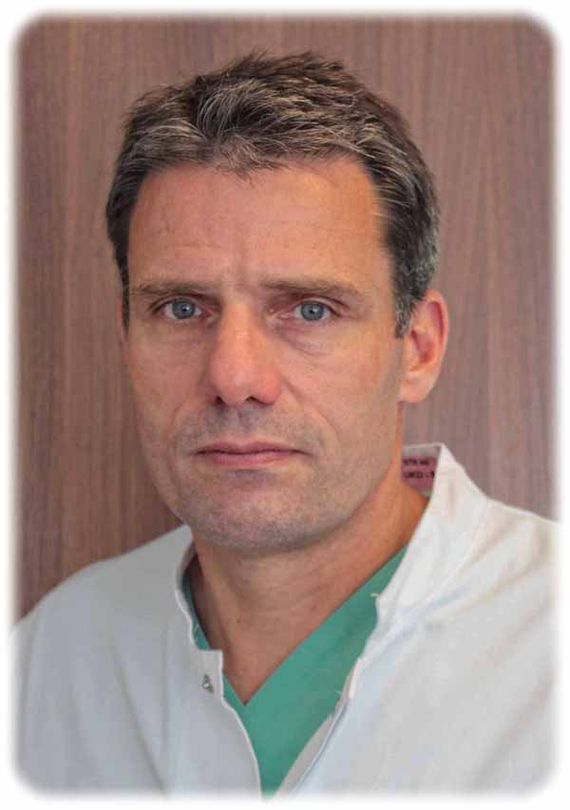
Prof. Jürgen Weitz. Foto: Heiko Weckbrodt
OP mit Steuerknüppeln und 3D-Bildern
Bei solch einem Eingriff öffnet er den Körper des Patienten nur mit einem kleinen Schnitt, durch den dann von seinem Team die dünnen Instrumente am Roboterarm eingeführt werden. Der Operateur selbst sitzt ein paar Schritte weiter an einer Konsole und steuert mit zwei „Joystick“-ähnlichen Steuerknüppeln und Pedalen die Greifarme über dem OP-Tisch. Ein optisches System übermittelt derweil ein dreidimensionales Bild aus der Brust und dem Bauch des Patienten an die Konsole, so dass der Chirurg in räumliches Gefühl dafür bekommt, wo er mit den Roboterarmen ansetzt.

DaVinci-Roboter noch ohne die Hüllen, die ihm im OP angelegt werden. Foto: Intuitive Surgicals
60-jähriger Krebspatient unterm Skalpell
Diesmal liegt im Dresdner Zentrum ein 60-Jähriger auf dem OP-Tisch, dem ein Teil der Speiseröhre entfernt werden, um den Rest dann wieder mit dem Magen zu verbinden. „Krebs“, sagt Weitz lakonisch. Der Tumor hat sich an einer besonders ungünstigen Stelle eingenistet, an die mit herkömmlichen Methoden nur aufwendig und umständlich heranzukommen wäre. Daher die Entscheidung für den Roboter.
Roboter kann Chirurgen-Bewegungen 10 zu 1 übersetzen
Der Telemanipulator hat Vor- und Nachteile, räumt der 48-Jährige Arzt ein, der bisher rund 50 Roboter-OPs geleitet hat. „Der entscheidende Vorteil ist die übersetzte Bewegung“, sagt er. „Ich kann das System so einstellen, dass aus einer einen Zentimeter weiten Handbewegung von mir eine Millimeter-Bewegung des Roboterinstruments wird.“ So könne sehr präzise operiert werden und beim Patienten komme kein Zittern an.

Für eine Roboter-OP wird ein mehrköpfiges Team benötigt, das die Vitalwerte des Patienten und die Narkosewirkung überwacht. Foto: Heiko Weckbrodt
Nachteil: Roboter-OP dauert länger, kein haptisches Handgefühl
Das sei bei schwierigen Eingriffen wie etwa einer Enddarm-Entfernung hilfreich. „Da will man natürlich die Nerven, die den Schließmuskel oder die sexuellen Funktionen steuern, nicht schädigen.“ Aber er sehe auch Nachteile: „Eine Roboter-OP dauert länger als eine klassische Operation, auch hat man kein haptisches Feedback wie bei OPs, bei denen man selbst die Instrumente führt. Daran gewöhnt man sich aber mit der Zeit.“
Selbstständige OP-Roboter erwiesen sich als Sackgasse
Auch haftet Roboter-OPs immer noch der Makel früherer Modelle an: Die waren nämlich wirklich Maschinen, wurden bei Hüftgelenk-Operationen eingesetzt, arbeiteten autonom nach einem einprogrammierten Schema, aber eben nicht präzise genug – hinterher klagten viele Patienten über starke Schmerzen. „Der Begriff Roboter-OP war danach sehr negativ belegt“, räumt Uniklinik-Sprecher Holger Ostermeyer ein.

Foto: Heiko Weckbrodt
Weltweit rund 3400 „Da Vinci“-Roboter installiert
Inzwischen sind OP-Roboter fast alle Telemanipulatoren, werden also von einem speziell ausgebildeten Chirurgen ferngesteuert. Sie dürfen also keinen Schnitt, keine Bewegung selbstständig machen. Eine nahezu monopolartige Stellung in diesem Sektor hat die US-amerikanische Firma Intuitive Surgicals, die nach eigenen Angaben weltweit rund 3400 dieser „Da Vincis“ installiert hat. Auch der OP-Roboter im Uniklinikum ist solch ein Modell. Den ersten kauften die Dresdner 2006, mittlerweile ist ein Nachfolgemodell installiert.
Uniklinik setzt immer öfter auf Tele-Eingriffe
Und die Uniklinik-Mediziner setzen den „Da Vinci“ immer häufiger ein: 154 Roboter-OPs waren es im Jahr 2014 – etwa doppelt soviele wie vor fünf Jahren. Das liegt auch daran, dass am Uniklinikum inzwischen mehr Ärzte für den Roboter ausgebildet sind: Anfangs operierte hier nur Urologie-Professor Manfred Wirth mit dem Telemanipulator, sitzen auch Professor Jürgen Weitz und die Frauenheilkundlerin Professor Pauline Wimberger oft an den Hebeln.
Video von der Roboter-OP (Achtung: Nichts für Zartbesaitete):
Technik ist teuer – im Kauf wie im Betrieb
Aus medizinischer Sicht negative Erfahrungen haben die Ärzte mit dem „Da Vinci“-System keine gemacht. Aber: Die Technik ist alles anderes als billig – sowohl in Anschaffung als auch Unterhalt. Der Roboter selbst kostet je nach Ausführung bis zu zwei Millionen Euro, dazu kommen Schulungskosten für die Mitarbeiter. Zudem haben die Instrumente, mit denen diese Roboter bestückt sind, eine vom Hersteller vorgegebene Nutzungsdauer: Hat der interne Zähler das Limit erreicht, muss zwingend ein neuer Aufsatz gekauft werden.
Klinik bekommt von Kasse nur Geld für „normale“ OP erstattet
Ein weiteres Problem: In der Regel bekommen Kliniken, die Da Vincis einsetzen, von den Krankenkassen nur eine normale OP erstattet. Die Mehrkosten für den Robotereinsatz müssen sie aus dem eigenen Budget decken. Bemühungen einzelner Krankenhäuser, das kostenintensivere Verfahren mit neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zusätzlich vergütet zu bekommen, waren nicht erfolgreich, sagte die Sprecherin der AOK Plus, Hannelore Strobel.
Einsatz nur, wenn medizinischer Vorteile offensichtlich sind
Das Uniklinikum fühlt sich dem Gedanken verpflichtet, sich auch mit neuen OP-Techniken auseinander zu setzen, betont Weitz. „Wir setzen den OP-Roboter aber nur für Patienten ein, wo die medizinischen Vorteile klar auf der Hand liegen.“ Bisher gebe es keine belastbaren repräsentativen Studien, die eindeutige medizinische Vorteile nachweisen. Aber Hinweise aus der operativen Praxis, dass Roboter-OPs mit weniger Blutverlust und Komplikationen in der Folge verbunden seien als bei klassischen Operationen. „Ich persönlich glaube aber, dass der OP-Roboter seine Vorteile noch zeigen wird und zum Beispiel in der Bauchchirurgie noch mehr Einsatzfelder finden wird“, sagt Weitz.
Militär wollte „kostbare“ Chirurgen vom Schlachtfeld fernhalten
Möglich wurde diese Präzisions-Chirurgie, die heute vor allem für Patienten mit schwer zugänglichen Tumoren im Bauch und Unterleib eingesetzt wird, allerdings erst durch die Fortschritte der Computertechnik, Robotik und Mikroelektronik. Ende der 1980er Jahre gab die US-Armee beim damaligen „Stanford Research Institute“ ein Entwicklungsprojekt in Auftrag, das durchaus zynische Noten hatte: Um das kostbare Leben teuer ausgebildeter Militärchirurgen zu schonen und sie nicht den Risiken eines nahen Schlachtfeldes auszusetzen, sollten fortan in Feldlazaretten Roboter-Operationssäle aufgebaut und dann von Ärzten in den USA ferngesteuert werden.
Militärprojekt für Fern-OPs scheiterte an langen Signal-Laufzeiten
Diese Idee, Soldaten ferngesteuert operieren zu lassen, scheiterte letztlich: Die Befehlssignale an den Roboter wurden zwar fast mit Lichtgeschwindigkeit – also knapp 300.000 Kilometern je Sekunde – übertragen. Dennoch erwiesen sich die Signallaufzeiten zwischen Amerika und den weltweiten Kriegsschauplätzen des US-Militärs als zu lang: Die Verzögerung zwischen den Bewegungen der Chirurgen und denen der Roboter in Tausenden Kilometern Entfernung und den wieder zurückgesandten Bildern vom OP-Tisch andererseits war einfach zu groß für sichere Operationen – auch wenn es sich nur um ein paar Zehntelsekunden handelte.
Technologische Fortschritte beim zivilen Einsatz
Aber bald fanden sich Interessenten aus dem zivilen Sektor: 1995 wurde in Kalifornien das Medizintechnik-Unternehmen „Intuitive Surgical“ gegründet, das diese Militär-Technologie aus den 80er Jahren weiterentwickelte und 1999 den ersten „Da Vinci“-Operationsroboter vorstellte. Statt die Befehle zwischen Chirurg und Roboter über Tausende Kilometer per Funk zu übertragen, sitzt der menschliche Operateur hier im selben Raum wie sein künstlicher Kollege. Dadurch fällt das Problem der langen Signallaufzeiten weg.
Zudem haben sich Robotik und Bildgebungs-Technologien derweil rasant weiterentwickelt. Heutige „Da Vinci“-Roboter zeigen dem Chirurgen an der Steuerkonsole in Echtzeit 3D-Aufnahmen aus dem Körper des Patienten, was noch vor 25 Jahren an zu langsamen Grafikchips gescheitert wäre. Auch haben die Greifarme des Roboters selbst, auf die Skalpelle, Nähgreifer, elektrische Brenner und andere OP-Instrumente aufgesteckt werden, inzwischen so viele Freiheitsgrade, dass der Chirurg sie mit seinen Steuerknüppeln und Pedalen ähnlich geschmeidig wie eine menschliche Hand bewegen kann. Selbst ein so komplizierter Bewegungsablauf wie das Zunähen einer Wunde ist mit solchen Roboter-Manipulatoren inzwischen kein Problem mehr.
Fern-OPs per Roboter inzwischen vorstellbar
Sowohl Hersteller wie auch Fachleute aus Medizin und Elektronikforschung halten es auch nicht für ausgeschlossen, dass die ursprüngliche Fern-OP-Idee des US-Militärs vielleicht doch noch Realität werden konnte. „Das Da-Vinci-Chirurgiesystem könnte theoretisch genutzt werden, um über große Distanzen zu operieren“, schätzte „Intuitive Surgical“ ein. Diese Fähigkeit sei aber in den aktuellen Modellen nicht verfügbar. Nicht weit vom Universitätsklinikum Dresden, im „5G Lab Germany“, arbeiten Forscher derweil bereits daran, im Mobilfunk der nächsten Generation (5G) die Reaktionszeiten auf eine Millisekunde (Tausendstel Sekunde) zu drücken, um auch Fern-OPs zu ermöglichen. Auch Roboter-OP-Spezialist Prof. Jürgen Weitz hält solch eine Entwicklung für denkbar: „Wenn es diese Verzögerungen nicht mehr gibt, halte ich Roboter-Operationen auch aus der Ferne für vorstellbar“, sagt er. „Aber das kann nur funktionieren, wenn man ein eingespieltes und gut geschultes Team vor Ort hat – nicht nur den Roboter allein.“
Für den 60-jährigen Mann mit Speiseröhrenkrebs, den Weitz an diesem Tag mit Unterstützung des künstlichen Kollegen operiert hat, war der Eingriff übrigens erfolgreich. „Dem Patienten geht es gut.“ Autor: Heiko Weckbrodt

Ihre Unterstützung für Oiger.de!
Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:
Vielen Dank!
