
Da freuen sich Operateur und Patient: Vor 20 Jahren hat Urologie-Professor Manfred Wirth (rechts) im Uniklinikum Dresden dem Drucker Karsten Dürr eine Spenderniere eingepflanzt – und die funktioniert heute immer noch. Foto: Heiko Weckbrodt
Inzwischen acht Jahre Wartezeit auf Spenderorgan – viele sterben vorher
Dresden, 26. August 2015. Nierenpatienten in Ostsachsen müssen immer länger auf ein Spenderorgan warten. Im Universitätsklinikum Dresden stehen mittlerweile 318 Patienten auf der Warteliste für eine Nieren-Transplantation. Und in den vergangenen 20 Jahren hat sich hier die Wartezeit auf ein Spenderorgan von viereinhalb auf sieben bis acht Jahre fast verdoppelt. Gerade aber viele ältere Patienten haben oft nur noch eine Lebenserwartung von fünf Jahren, wenn sie einmal an eine künstliche Niere angeschlossen sind.
Organspende-Bereitschaft hat im Osten nachgelassen
Leider sei die Spenden-Bereitschaft in Sachsen und ganz Ostdeutschland inzwischen deutlich geschrumpft, ärgern sich Prof. Manfred Wirth, der Direktor der Urologie-Klinik, und Prof. Christian Hugo, Leiter des Bereichs Nephrologie, im Uniklinikum. „Wir haben inzwischen einen extremen Mangel an Spenderorganen“, sagt Prof. Wirth – und appelliert an die Sachsen, sich als Organspender zu registrieren.
Diesem Aufruf kann sich Karsten Dürr nur anschließen: Ihm hat solch eine Nierentransplantation, die vor 20 Jahren Prof. Wirth geleitet hatte, wahrscheinlich das Leben gerettet. „Ich habe inzwischen geheiratet, ich habe Kinder“, sagt er. Wer weiß, so meint er, ob er das alles überhaupt noch erlebt hätte ohne die neue Niere.
„Ich hatte ständig Schmerzen“
Bei ihm hat alles angefangen, als er gerade 15 war. „Zuerst war es nur hoher Blutdruck. Nach neun Monaten stellte sich heraus, dass mit meiner Niere etwas nicht in Ordnung war“, erinnert sich der heute 51-jährige Dresdner. „Ich hatte ständig Schmerzen.“ Anfangs halfen noch Medikamente, aber von Jahr zu Jahr ging es ihm immer schlechter. „Ich war häufig krank und das hat der Meister gar nicht gern gesehen.“ Damals arbeitete er als Apparateführer in der Lichtdruckerei in Dresden-Striesen, wollte nicht ständig fehlen – doch irgendwann ging es dann einfach nicht mehr.
Zu wenig künstliche Nieren in der DDR: Zu viele starben an Blutvergiftung
Mit Dialyse-Kapazitäten war es allerdings zu DDR-Zeiten schlecht bestellt: Wie in so vielen anderen Bereichen herrschte auch im Medizinsektor Mangelwirtschaft. „Deshalb sind viele Patienten in der DDR schlichtweg an einer Blutvergiftung gestorben“, schätzte Prof. Wirth ein. Es habe einfach zu wenig künstliche Nieren gegeben.
Künstliche Filter können echte Niere nie ganz ersetzen
Insofern war die Wende für Karsten Dürr in ganz besonderer Weise ein Glücksfall: Bald gab es genug Filter und 1990 entschieden die Ärzte, Dürr an solch eine künstliche Niere anzuschließen. Drei mal die Woche musste er sich fortan im Uniklinikum in einen großen Sessel setzen oder ein Bett legen und dann fünf Stunden lang sein Blut durch Filter pumpen lassen. Durch Filter, die dafür gedacht sind, die Entgiftungsfunktionen einer echten Niere nachzuahmen. „An den Wochenenden, wenn keine Dialyse war, hatte ich dann immer Wassereinlagerungen“, erinnert sich Dürr.
Denn so sehr sich die künstlichen Nieren auch inzwischen technisch verbessert haben: Ihr natürliches Gegenstück, das kontinuierlich 24 am Tag, 365 Tage im Jahr ununterbrochen unser Blut von allen möglichen Giftstoffen und Ablagerungen befreit und dabei auch noch Hormone produziert, können sie immer noch nicht vollauf ersetzen. „Zuletzt habe ich trotz Dialyse mich immer schwächer und schwächer gefühlt“, erinnert sich Karsten Dürr.
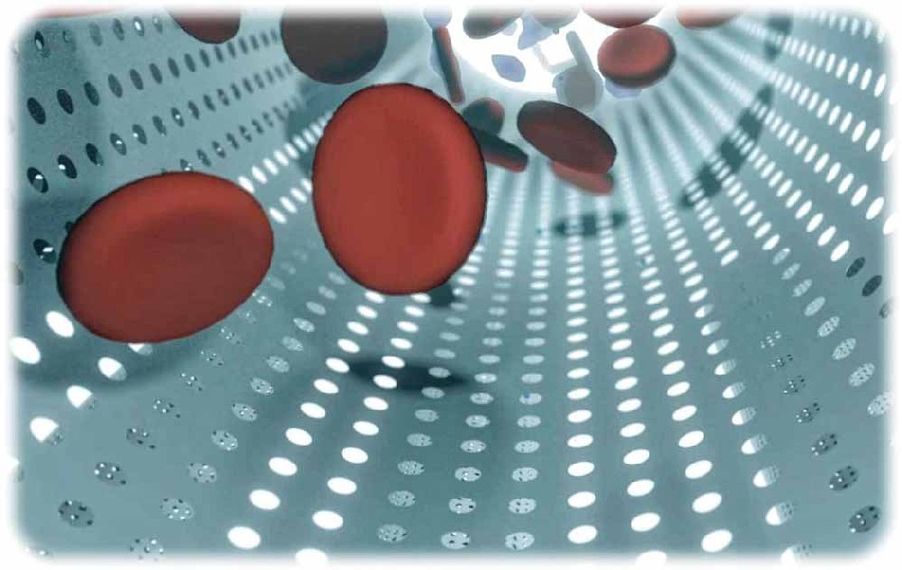
In einer künstlichen Niere (Dialysator) stecken Tausende Hohlfasern wie dieser, dessen kleine Wandlöcher Giftstoffe aus dem Blutstrom des Nieren-Patienten durchlassen, aber nicht die größeren Blutkörperchen. Bildschirmfoto aus Image-Video von B.Braun Radeberg
Ältere Patienten halten mit künstlicher Niere oft nur noch fünf Jahre durch
Das ist auch ein Grund, warum im Zweifelsfall die Nierentransplantation die bessere Wahl im Vergleich zur Dialyse ist: Von allen Fremdstoffen können die Apparate das Blut eben doch nicht reinigen. Dadurch kommt es unter anderem zu Gefäßverkalkungen und Stoffungleichgewichten im Körper. Während junge Nierenpatienten durchaus eine Lebenserwartung von noch 20 bis 30 Jahren bei einer Dauer-Dialyse haben, halten viele ältere Patienten mit diesem künstlichen Nieren-Ersatz oft nur noch fünf Jahre durch.
Eingepflanzte Niere funktioniert nach 20 Jahren immer noch
Doch für Karsten Dürr war es 1995 endlich soweit: Als einem der ersten Patienten überhaupt wurde ihm am damals gerade neuaufgebauten Transplantationszentrum im Uniklinikum Dresden durch Prof. Wirth eine Spender-Niere eingesetzt. „Wir hatten uns in der Familie gerade auf einen Urlaub vorbereitet, da kam die Nachricht, dass für mich eine Niere da ist“, erzählt Dürr. Dann ging alles ganz schnell: Zwei Tage nach seinem 31. Geburtstag wurde er operiert und als er aufwachte, hatte sich für ihn alles von Grund auf verändert: Keine Dialyse mehr, keine Schwächeanfälle mehr – es sei wie ein neues Leben gewesen, sagt er. „Für mich war das die Rettung.“ Auch heute noch, 20 Jahre danach, muss er zwar regelmäßig Medikamente schlucken, um eine Abstoßungsreaktion des „fremden“ Organs zu verhindern. Aber: „Die Niere ist noch voll funktionsfähig, sie arbeitet nahezu so gut wie vor 20 Jahren“, schätzt sein damaliger Operateur Prof. Wirth ein.
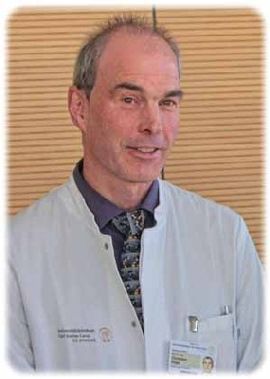
Prof. Christian Hugo ist im Uniklinikum Spezialist für Nephrologie (Nierenkunde) im Uniklinikum Dresden. Foto: Heiko Weckbrodt
Bundesweit immer weniger Nieren-Transplantationen
Andere Patienten hingegen hatten und haben nicht soviel Glück wie Karsten Dürr: Die Wartezeiten und die Wartelisten werden in Dresden wie auch bundesweit immer länger. Vor allem in den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Nierentransplantationen deutschlandweit um fast ein Drittel gesunken: Wurden 2010 noch knapp 3000 Nieren transplantiert, gab es im Jahr 2014 nur noch 2128 solcher OPs. Und das liegt nicht daran, dass es weniger Patienten gibt, vielmehr ist die Organspende-Bereitschaft der Deutschen gesunken. Dabei lag der Wille zu spenden in Ostdeutschland noch vor zehn Jahren überdurchschnittlich hoch – doch „leider hat sich dieses spezifische Hoch an Organspenden im Osten nicht gehalten und ist wie in den anderen Bundesländern auf gerade mal zehn bis zwölf Spenden pro Million Einwohner pro Jahr abgerutscht“, bedauert der Dresdner Nephrologe Prof. Christian Hugo.
Weniger Verkehrstote = weniger Spendernieren
Ein Grund für die sinkende Zahl an Spenderorganen ist eine an für sich erfreuliche Entwicklung: Airbag, Antiblockiersysteme und andere Sicherheitsverbesserungen an modernen Automobilen und Motorrädern haben dazu geführt, dass immer weniger Verkehrstote auf den Kliniktischen landen – und damit eben auch weniger potenzielle Organspender. Etwas zynisch könnte man formulieren: Airbags sind gut für Fahrer –aber schlecht für die Transplantationsmedizin.
Dämpfer auch durch Organspende-Skandal
Gedämpft wurde die Spendenbereitschaft aber zweifellos auch durch den Organspende-Skandal 2013, als bekannt wurde, dass an mehreren Transplantationszentren in Deutschland an den Listenplätzen von Organspende-Empfängern herumgemauschelt wurde. Auch am Uniklinikum Dresden hatte es daraufhin eine Prüfung gegeben. Zwar gab es hier keine Beanstandungen, aber am Spenderorgan-Mangel hat sich dennoch kaum etwas geändert.
Uniklinik legt gegen den Trend zu
Dennoch sieht die Uniklinik-Leitung positive Entwicklungen. So ist die Erfolgsquote der OPs in Dresden recht gut, je nach Alter des Patienten liegt sie bei 85 bis 95 Prozent – gemessen daran, in wie vielen Fällen die eingepflanzte Spenderniere auch nach einem Jahr noch ordentlich funktioniere. Seit der ersten Nierentransplantation am Standort vor 20 Jahren habe man insgesamt 769 Patienten eine neue Niere einsetzen können und entgegen dem bundesweiten Trend habe es zuletzt sogar einen Aufwärtstrend gegeben: Erfolgten 2013 nur 52 Nierentransplantationen, waren es im Folgejahr 76 und bis heute wurden in diesem Jahr auch schon 57 solcher OPs vorgenommen. Das liege aber auch daran, dass sich das noch vergleichsweise junge Transplantationszentrum in Dresden inzwischen einen guten Ruf erarbeitet habe, schätzte Prof. Wirth ein. Mittlerweile habe man Patienten aus ganz Sachsen und teils auch aus Brandenburg, obwohl es in Leipzig und Berlin bereits langetablierte Nieren-Transplantationszentren gibt.
„Pilotpatient“ Karsten Dürr hat seine Entscheidung, sich unter Professor Wirths Messer zu legen, nicht bereut – und würde es auch wieder tun, wenn seine Spenderniere irgendwann einmal versagen sollte. Gar nicht verstehen könne er allerdings, warum sich nicht mehr Menschen als Organspender eintragen lassen: „Damit kann man anderen Menschen so sehr helfen“, sagt er. Und wenn man einmal tot sei, brauche man nun mal auch keine Niere mehr.
Autor: Heiko Weckbrodt
Zum Weiterlesen:
Wer entscheidet, wer eine Spender-Niere bekommt?
B.Braun baut in Sachsen modernste Dialysatoren-Fabrik Europas
So funktioniert eine künstliche Niere

Ihre Unterstützung für Oiger.de!
Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:
Vielen Dank!

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.